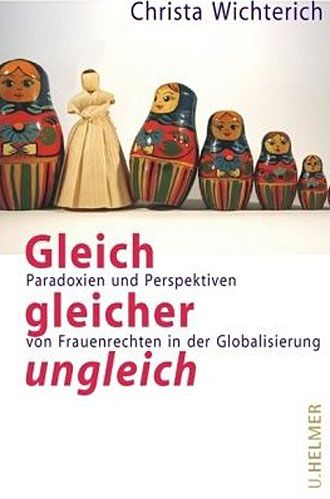Vor einem Jahr krachte es an den Börsen. Seither wurden Ursachen für die Krise gesucht, eine Suche, die schon mal US-BürgerInnen, die ja unbedingt alle eine Häuschen gebraucht hätten oder die allzu risikobereite "männliche" Stimmung auf den Finanzmärkten in den Fokus nahm. Geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen mussten schon des Öfteren für Krisen- Analysen herhalten. Derweil steigen die Arbeitslosenzahlen beträchtlich und viele Unternehmen führen vor dem Hintergrund der Krise Flexibilisierungen und Lohnkürzungen ein. Beate Hausbichler sprach mit der Soziologin Christa Wichterich über den Krisen-Diskurs im letzten Jahr, vergeschlechtlichte Märkte und die derzeitige "Chance" für Unternehmen zu flexibilisieren.
********
dieStandard.at: Seit Beginn der Wirtschaftskrise werden Frauen gerne als die "besseren" Kapitalistinnen vorgeführt - weniger risikobereit, teamfähiger, fleißiger, flexibler, denken nachhaltiger usw. Was halten Sie davon?
Christa Wichterich: Das ist die erste Krise, bei der das so geschieht. Es ist insofern interessant, weil es den Blick darauf richtet, dass die Märkte und auch die Krise vergeschlechtlichte Prozesse sind, in denen Männer und Frauen eine unterschiedliche Rolle spielen. Diese Rollen werden in der Krise auf einmal hinterfragt. Das hat im Jänner begonnen, als der "Observer" in England gefragt hat: "Wäre der Crash auch gekommen, wenn die Lehman-Brothers Sisters gewesen wären?" Es wurden auch gleich Studien nachgeschoben, die zeigten, dass sich an den Börsen und Banken eine Kultur der Zocker-Männlichkeit mit einem zu hohen Testosteronspiegel entwickelt hat. Das hatte zur Folge, dass es eine zu hohe Risikobereitschaft gibt und Spekulationen vorangetrieben werden, die dann zum Crash führten. Das ist eine individualistische Analyse der Krise und eine solche lenkt von den Gesetzmäßigkeiten des Finanzmarktes ab, die dazu antreiben, immer neue Finanzmarktinstrumente zu erfinden, Wetten abzuschließen und zu spekulieren, um die Rendite zu steigern, das heißt aus Geld mehr Geld zu machen. Das führt zwangsläufig zu Blasen und schließlich zu einem Crash. Wenn man nur auf die Individuen schaut, die da eingespannt sind, lenkt das von den Gesetzmäßigkeiten des Marktes und davon ab, nach welcher Logik dieser funktioniert.
Die Kritik am Zockerverhalten Einzelner und der männlichen Finanzmarkt-Kultur ist völlig berechtigt wie auch die Kritik daran, dass die Gier nach Boni für Risiken blind macht, Risiken, die auf die Gesellschaft verlagert werden und nicht von den Verantwortlichen getragen werden. Das ist alles richtig. Nur diese Form, die Kritik nur auf Individuen zuzuspitzen, auf individuelle Boni-Geilheit und auf Männlichkeit, das geht an der Funktionslogik des Marktes vorbei. Frauen würden sich in den entsprechenden Positionen dieser Funktionslogik und den Zwängen des Marktes und des Geldes, immer weiter zu wachsen, auch nicht entziehen können. Aber ganz unabhängig davon: Frauen haben auf allen gesellschaftlichen Ebenen und auf allen Märkten ein gleiches Recht auf Karriere, auf Führungspositionen und auf Macht, auch auf Fehler. Das ist eine andere Geschichte.
dieStandard.at: Erst im Juli wurde in Deutschland gemeldet, dass im Gegensatz zur Arbeitslosigkeit der Männer, jene der Frauen weiter sinkt. Profitieren Frauen von der Krise?
Wichterich: Man muss sich ansehen, wo wirkt die Krise und wie. Man spricht von unterschiedlichen Kaskaden-Effekten der Krise, von Erstrunden-Effekten, von Zweitrunden-Effekten usw. Die Krise wirkt schnell auf die Exportsektoren, diese sind in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gestaltet. Bei uns sind das vor allem die männerdominierten Automobil- und Maschinenbaubereiche, in den Ländern des Südens sind es arbeitsintensive Industrien wie die Textil, Spielzeug- oder Elektronikproduktionen, die von Frauen dominiert sind. Daher stellt sich das Bild in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich dar. In Kambodscha sind 92 Prozent der Entlassenen Frauen. Bei uns sind von den Erstrunden-Effekten Männer betroffen, weil Männer in konjunkturanfälligeren Branchen arbeiten, wie etwa der Auto- und der Bausektor. Daher sieht es auf den ersten Blick so aus, als wären Frauen weniger betroffen, weil sie vorwiegend im Dienstleistungsbereich beschäftigt sind. Dieser leidet im Moment noch nicht, aber es ist ganz klar absehbar, dass bei den Zweitrunden-Effekten, wenn der Staat im öffentlichen Sektor kürzt, Frauen in den Bereichen wie Erziehung oder Gesundheit stark betroffen sein werden.
Aber was heißt "profitieren"? Auf dem Arbeitsmarkt ist von einer Feminisierung der Beschäftigung die Rede, weil mehr Frauen erwerbstätig sind. Aber in welchen Beschäftigungsformen? Es ist ein globales Phänomen: Frauen sind vorwiegend in niedrigentlohnten, informellen oder in Teilzeitjobs tätig. Die Rolle, die der Arbeitsmarkt Frauen zuschreibt, ist also die der Zuverdienerin. Gleichzeitig gibt es aber den männlichen Familienernährer nicht mehr so wie früher. Diese Rolle wird abgebaut, weil die Reallöhne sinken und auch die Arbeit von Männern flexibilisiert wird. Somit wird die sogenannte Zuverdienerinnen-Rolle immer wichtiger, aber der Markt bewertet das nicht angemessen. Die Jobs, die Frauen machen, werden weiterhin niedrig entlohnt. Und hier kommt man auf das sehr sensible Problem der Bewertung von Arbeit. Arbeit wird sehr geschlechtsgebunden bewertet: Männerarbeit wird prinzipiell höher bewertet und besser entlohnt als Frauenarbeit, vor allem dann, wenn die Arbeit von Frauen haushalts- und personennah ist.
dieStandard.at: "Die Zeit" zitierte kürzlich den Sozialwissenschafter Klaus Hurrelmann, der meinte, Frauen würden sich zwar auch an Leistung orientieren, "rechnen aber nicht damit, dass am Ende auch mehr Geld dabei rausspringt". Wird die Krise genutzt, um Erwartungen an Löhne oder Dienstverhältnisse runter zu schrauben?
Wichterich: Wenn man sich die Analysen früherer Krisen in anderen Ländern anschaut, stellt man fest, dass Krisen immer genutzt wurden, um Arbeit zu flexibilisieren und Löhne abzusenken. Die Asienkrise hat gezeigt, dass sich die ökonomischen Zahlen nach etwa zwei Jahren erholt hatten, die Löhne hingegen waren erst nach sieben Jahren auf dem Niveau, als die Krise einsetzte.
Frauen stellen auf den Erwerbsmärkten geringere Ansprüche als Männer. Bei Einstellungsgesprächen - das trifft bei Arbeitsplätzen mit niedrigem Qualifikationsniveau genauso zu wie für Managerinnen - fordern Frauen weniger als Männer. Deswegen werden Frauen tariflich niedriger eingestuft. Das gilt ohnehin für flexible Beschäftigungsformen. So wird zum Beispiel Kantinenpersonal in Betrieben nicht als Stammpersonal geführt, sondern als Randbelegschaft und damit werden sie schlechter bezahlt. So reproduziert sich das System. Und hier kommt die Krise den Unternehmen sehr recht, um zu sagen, wir stehen unter Druck und können nur wenig zahlen, nur flexibel beschäftigen usw.
dieStandard.at: Sie haben mal in einem Text für die "taz" geschrieben, dass der Staat in Krisenzeiten die Risiken von oben nach unten umverteilt - somit würde das Risiko letztlich von Frauen aufgefangen. Wie bzw. in welcher Form?
Wichterich: Die Krise zeigt ja sehr deutlich, dass die Märkte eine Hochrisikoterrain sind. Die Finanzmärkte mit ihren wahnwitzigen Spekulationen, aber auch die Erwerbsmärkte. Wenn wir schauen, wie sich die Märkte und die Preise - von denen KonsumentInnen betroffen sind - verändert haben, dann sehen wir, wie in den letzten Jahren Risiken auf die unteren Ebenen verlagert wurden. Beispielsweise dadurch, dass die Exportarbeiterinnen in vielen Ländern inzwischen Leiharbeiterinnen sind, das heißt sie werden von der Leiharbeitsfirma in die Fabrik geschickt, wenn ein Auftrag reinkommt. Das Risiko der Exportabhängigkeit von Aufträgen aus dem Ausland verlagert das Unternehmen an die Arbeiterinnen. Das Risiko, ob ein Hotel die Zimmer belegt hat, tragen "Zimmermädchen", die nur noch pro gemachtes Bett bezahlt werden. So lange es keine Mindestlöhne für Hotelbeschäftigte gibt, werden sie so bezahlt. Und: Die Preise für Lebensmittel sind im letzten Jahr enorm gestiegen, weil auf Nahrungsmittelernten gewettet wurde. Die Spekulationsblase hat sich in inflationär steigende Preise für Getreide und Reis übersetzt. Die Risiken dieses Spekulationsmarktes tragen letztlich jene, die diese teuren Lebensmittel kaufen müssen.
dieStandard.at: Die Trennung von Reproduktions- und Produktionsarbeit soll ihrer Ansicht nach aufgehoben werden. Wie stellen Sie sich die Zukunft von reproduktiver Arbeit vor?
Wichterich: Es muss sich an dem gesamten System von Arbeit etwas ändern. Dazu müssen wir das Ganze von Arbeit in den Blick nehmen, also die Erwerbsarbeit, aber auch unbezahlte Arbeit, die die Versorgung der Gesellschaftsmitglieder im Alltag gewährleistet. Und wie gesagt: Für die Erwerbsarbeitsmärkte ist die Bewertung von Arbeit wichtig und sie ist nicht abtrennbar von der Kategorie Geschlecht und der systemischen Diskriminierung von Frauen. Nun plädiere ich - wenn sich an dem ganzen System, wie Arbeit verausgabt wird, etwas ändern soll - für eine Umverteilung und Neubewertung von Arbeit. Die Idee ist, dass jede/jeder in der Gesellschaft einen Teil Sorgearbeit und einen Teil bezahlte Arbeit übernimmt. Die Geschlechtsbindung von Arbeit, und das heißt vor allem die Bindung von Sorgearbeit an Frauen, muss aufgehoben werden. Diese Normen müssen auch auf den Erwerbsmärkten geknackt werden, wo immer noch eine starke Geschlechtssegmentierung herrscht. Die Leitung der gesamten Wirtschaft und der Konzerne ist immer noch männlich konnotiert. Die ersten Schritte zu einem neuen Modell von Arbeit könnten sein: Arbeitszeitverkürzung für bezahlte Arbeit, gleichzeitig muss unbezahlte Arbeit zwar nicht entlohnt werden, aber es muss soziale Sicherheitsansprüche dafür geben. Jene die Kinder oder Alte versorgen, sollten auch Rentenansprüche mit dieser Versorgungsarbeit erwerben. Es sollte nicht alle Arbeit über Marktverträge abgewickelt werden, sondern viel mehr über soziale Verträge.
dieStandard.at: Zunehmend werden Reproduktionsarbeiten wie etwa Reinigungsarbeiten an MigrantInnen ausgelagert, für ein paar Stunden im Monat können sich das schon viele leisten, wenn beispielsweise 8 Euro die Stunde bezahlt werden. Wird so die Reproduktionsarbeit wieder vermehrt auf den Markt gebracht?
Wichterich: Der Haushalt ist ein Bereich, wo undokumentierte MigrantInnen ganz massiv einbezogen werden. Das hat nichts mit dem Aufbrechen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zu tun, aber viel mit der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes - oder wie es die SoziologInnen nennen - mit einer Unterschichtung des Marktes. Statt durch Mindestlöhne eine untere Grenze einzuziehen wird durch die Beschäftigung von undokumentierten MigrantInnen nach unten hin immer weiter in Richtung Lohn- und Sozialdumping aufgeweicht. Das kann doch nicht unser Ziel sein. Wenn wir für die Märkte eine allgemeine Gerechtigkeitsnorm setzen wollen, müssen Mindeststandards durch Mindestlöhne gesetzt und Rechte garantiert werden, statt neue Diskriminierungen zuzulassen. Für jeden/jede ein Grundeinkommen und ein Umbau durch Neubewertung und Umverteilung von Arbeit, das würde neue Möglichkeitsstrukturen schaffen.
dieStandard.at: In ihrem im Oktober erscheinenden Buch soll es um "Paradoxien von Frauenrechtskämpfen, Gleichstellungspolitiken und Entwicklungskonzepten" gehen. Von welchen Paradoxien sprechen Sie?
Wichterich: In den vergangenen Jahrzehnten wurden zweifelsohne große Gleichstellungsfortschritte gemacht. Die Geschlechterrollen- und Verhältnisse sind in Bewegung gekommen. Frauen haben Lebensmöglichkeiten, von denen ihre Großmütter nur geträumt haben. Aber die geschlechtsspezifische Arbeit ist bei weitem nicht geknackt. Zwar sind immer mehr Frauen in die Erwerbsarbeit reingekommen und somit gab es eine starke Flexibilisierung und Erweiterung von Frauenrollen. Aber Männer haben keineswegs in gleichem Ausmaß Versorgungsarbeiten übernommen. Männliche Rollen haben sich viel weniger flexibilisiert als weibliche Rollen. Von Gleichheit noch weit entfernt stellen wir also fest, dass sich in vielen politischen Bereichen, in der Beschäftigungspolitik, in der Gleichstellungspolitik bei uns aber auch in der Entwicklungspolitik, eine Gender.Fatigue breitgemacht hat, eine Geschlechtererschöpfung. Die Politik sagt: Ach nein, nicht wieder das Thema, Frauen sind doch soweit vorangekommen. Gleichzeitig stellen wir fest, dass Geschlecht immer noch ein Ordnungsprinzip in der Gesellschaft und - neben anderen - immer noch als Kategorie der Diskriminierung und sozialer Ungleichheit wirkt, obwohl Frauen immer weiter in die Öffentlichkeit, in die Medien, in die Politik, in die Erwerbsarbeit integriert wurden. Das nenne ich eine paradoxe Integration, denn weiterhin bestehen Ungleichheiten und auch die Krise wirkt so, dass Frauen als soziale Air Bags funktionieren, wo sie viel auffangen, viele Kosten übernehmen. Somit werden soziale Ungleichheiten - auch zwischen Frauen - erneut verstärkt. Mein Buch beschäftigt sich mit diesen Widersprüchlichkeiten und den weiterhin bestehenden sozialen Ungleichheiten. (Beate Hausbichler, dieStandard.at, 19.9.2009)