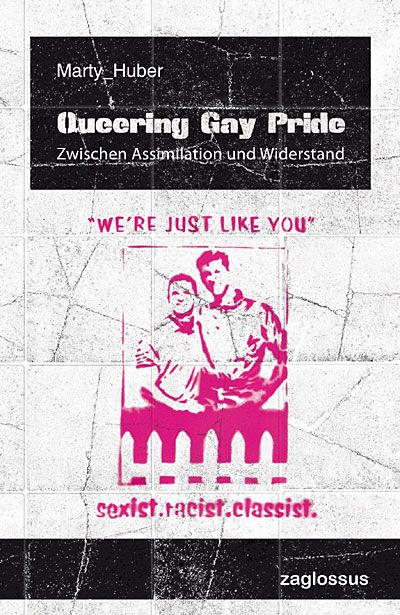In vielen europäischen Städten sind Gay Prides ein willkommener politischer Aktivismus. Eine Stadt kann mit ihnen nicht zuletzt Weltoffenheit und eine liberale Geisteshaltung demonstrieren. Auf der anderen Seite kommen mit einer kommerziellen Vereinnahmung der Prides wesentliche politische Inhalte zu kurz, so die Theaterwissenschaftlerin und Aktivistin Marty Huber. In ihrem Buch "Queering Gay Pride. Zwischen Assimilation und Widerstand" hat sie sich mit den verschiedenen lokalen Ausformungen von Gay Prides beschäftigt und mit der Frage, wie sich diese lokalen Bewegungen gegenseitig beeinflussen. Sie nahm dabei insbesondere die Nord-Süd-Achse Amsterdam, Wien, Budapest, Belgrad in den Blick und ging der Frage nach, wie trotz Vereinnahmungsversuchen politische Interventionen möglich bleiben.
dieStandard.at: Sie haben sich nicht nur theoretisch mit Gay Prides beschäftigt, sondern sind selbst sehr aktiv. Wann waren Sie zum ersten Mal bei einer Gay Pride?
Huber: 1996. Das war damals die erste Parade in Wien. Für mich ist es spannend, wie ich mit meinen persönlichen Erfahrungen in meiner theoretischen Arbeit umgehen kann – ich möchte diese Erfahrungen nicht negieren und gleichzeitig theoretisch präzise sein.
Es gibt derzeit wieder eine stärkere Annäherung zwischen Praxis und Theorie – das zu vermischen war ja lange verpönt. Im politischen Handeln nehmen wir uns aber in unserer Handlungsfähigkeit wahrscheinlich etwas weg, wenn wir persönliche Erfahrungen außen vor lassen.
dieStandard.at: Wie stark haben sich die Gay Prides im Lauf der Jahre verändert?
Huber: Es gab schon Demonstrationen für die Rechte von Lesben und Schwulen seit den 70ern in Österreich, vor den Gay Prides. Etwa den "Rosa Wirbel": Nackte Männer sind beim Neujahrskonzert auf die Bühne gestürmt, um für Rechte für Lesben und Schwule zu demonstrieren.
Was alle Prides – von heute und damals – miteinander verbindet, ist die Idee einer feiernden Demonstration oder einer demonstrierenden Party. Dieser Hybrid ist nicht ganz einfach, aber wirkungsvoll. Es geht vor allem um das gemeinsame Besetzen von öffentlichen Räumen, um ein Ende des Sich-verstecken-Müssens. Und eben um das miteinander Feiern.
Derzeit wird aber im Mainstream dieser Party-Aspekt sehr hervorgehoben. Es darf aber nicht vergessen werden, dass es bis 2002 eine dezidierte Gesetzgebung gegen Homosexualität gab. Das Werbe- und Vereinsverbot fielen erst Mitte der 90er und das unterschiedliche Schutzalter wurde 2002 aufgehoben. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass die Geschichte der Diskriminierung eine sehr junge ist und sich noch immer fortsetzt, etwa auch in Fragen der Trans*Genderpolitik. Das ist in den Paraden sehr unterschiedlich sichtbar.
Aktuell wird etwa die Homo-Ehe quasi als einzige Forderung hervorgehoben. Es wird im Zuge der Paraden und in der diesbezüglichen Berichterstattung kaum über etwas anderes gesprochen. Und seit aktuell vermehrt Fortpflanzungsrechte diskutiert werden, kommen plötzlich wieder mehr Lesben vor. Was eine ziemliche Reduktion auf die Gebärfähigkeit ist.
dieStandard.at: Die Stadt Wien steht der Gay Pride sehr positiv gegenüber. Lange davor fahren die Straßenbahnen mit Regenbogenfahnen durch die Stadt.
Huber: Die Stadt hat das sehr gewollt. Es gab ein gegenseitiges Begehren, also auch von der LGBT-Community (LGBT steht für lesbian, gay, bisexual, und transgender, Anm.), diese Kombination aus Feiern und Demonstrieren in die Stadt zu holen.
Sich Liberalität anheften wurde zum städtischen Gewinn, ein Tourismus-Magnet. In Wien kann man dieser Kommerzialisierung bei den Paraden aber noch gut etwas entgegensetzten. In Amsterdam ist das hingegen so gut wie unmöglich.
dieStandard.at: Warum?
Huber: Seit Mitte der 90er findet die Canal Pride auf den Grachten statt. Die wurde anfangs von der Gay Business Association veranstaltet – was ja auch schon einiges aussagt. Sie sollte eine Werbefläche für schwule und lesbische Verbände schaffen. In Amsterdam gibt es durch den Kanal, der die TeilnehmerInnen auf Boote zwingt, eine massive Trennung zwischen den TeilnehmerInnen und den ZuschauerInnen. Es gibt keine Möglichkeit des Kontakts. In Wien tanzt man mal da, mal dort mit.
Die Kommerzialisierung geht sogar so weit, dass sich einige Banken und Versicherungen zu einer sogenannten "Personal Pride = Company Pride" zusammenschlossen. Das Coming-out, verstanden auch als eine persönliche Weiterentwicklung, wird also auch von Firmen eingenäht. Die Bewegungen sollen produktiv verwertet werden.
Es ist aber nicht so, dass böse Konzerne kommen und diese Bewegungen schlucken. Es gibt auch das Begehren, geschluckt zu werden: Natürlich will ich etwa eine Computerfirma, die mich als LGBT anerkennt und wo ich keine Angst haben muss, am Arbeitsplatz ausgeschlossen zu sein.
Ich freue mich auch immer sehr, wenn ich die Regenbogenfähnchen auf den Straßenbahnen sehe – dennoch frage ich mich: Reicht das, um Homophobie und Transphobie zu bekämpfen?
dieStandard.at: Welche Forderungen fallen unter den Tisch?
Huber: Derzeit haben wir einen sehr starken Gleichstellungsdiskurs. Mit diesem kann ich mich aber nur dem Status quo angleichen. Das ist politisch ein völlig anderer Ansatz, als zu sagen: Ich will eine andere Gesellschaft!
dieStandard.at: Die Forderung nach der Ehe für Lesben und Schwule ist somit eine Forderung, mit deren Umsetzung auch wieder ein Schritt zurück gemacht wird?
Huber: Denken wir an Möglichkeiten der sozialen Absicherung. Derzeit kann man sich nur als monogames Paar absichern. Dabei ist es eine alte feministische Forderung, dass man bei diesen Fragen nicht auf eine Paarkonstellation reduziert werden sollte.
dieStandard.at: In manchen Städten ist das Gegenteil von Vereinnahmung von Gay Prides der Fall und es kommt zu tätlichen Übergriffen.
Huber: Es ist ein Problem, wenn manche LGBT-Communities Empfehlungen an andere aussprechen, womöglich an solche in Ländern, wo Homophobie noch viel stärker ausgeprägt ist als bei uns. Dabei wird manchmal überhaupt nicht auf die lokalen Unterschiede geachtet und das Rezept "one thing fits all" gegeben. Das geht so weit, dass in EU-Fortschrittsberichten für Serbien drinsteht: "Ihr müsst Gay Prides ermöglichen."
Man muss genauer überlegen, wie Solidarität aussehen kann, ohne irgendwelche Rezepte aufzudrängen.
dieStandard.at: Gay Prides – das Auf-die-Straße-Gehen – könnten ja in Zeiten des Netzaktivismus fast ein bisschen antiquiert anmuten, oder?
Huber: Die Frage ist, wo Kollektivität spürbar ist. Sich gemeinsam im öffentlichen Raum bewegen, auch unter schwierigen Umständen, das ist schon eine besondere Erfahrung. Das gilt auch, wenn – wie in Budapest – die Pride in einem völlig abgeschotteten Raum stattfindet. Seit dem Angriff auf die Parade 2007 wurde immer mehr abgesperrt. Jetzt ist die Situation so, dass man die ganze Andrássy út durch einen menschenleeren Kordon geht. Es gibt einen Eingang am Anfang und am Ende, der Rest ist abgesperrt.
Viele fragen sich, was für einen Sinn eine Parade macht, die niemand sieht. Die Paraden sind aber nicht nur für die da, die zuschauen kommen. Auch. Aber wir machen es vor allem für "uns" – wer immer das ist. Diese Gruppen von AktivistInnen sind sehr divers. Die Erfahrungen innerhalb dieser Gruppen sind viele wichtiger als die Frage, wer zusieht.
dieStandard.at: Sie haben sich im Buch generell mit der Trennung bzw. Aufhebung zwischen Zuschauen und Teilnehmen beschäftigt.
Huber: Bei einer Pride in Wien gab es dazu die schöne Aktion "Rosa Lila Guerilla Love Attacks". Wir gingen mit "Happy Coming Out"-Stickern auf die ZuschauerInnen zu, haben ihnen gratuliert und gesagt: "Super, Coming out – schön, dass du da bist!" Wir haben damit sozusagen womöglich "falsch anerkannt". Bei Paraden ist es immer wieder möglich, Dinge zu "queeren" – sich Frechheiten zu erlauben und Dinge auf den Kopf zu stellen. Wie eben bei dieser Aktion das Verhältnis zwischen TeilnehmerInnen und ZuschauerInnen. Plötzlich waren sie die, die sie zuvor bestaunten. (Beate Hausbichler, dieStandard.at, 20.10.2013)