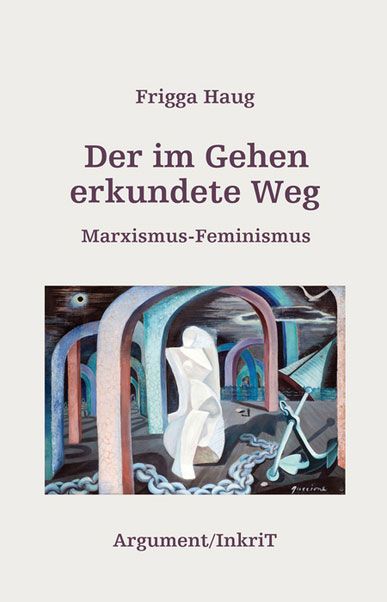dieStandard.at: Sie setzen sich für eine Verkürzung der Lohnarbeit zugunsten dreier weiterer Arbeitsbereiche ein: der Entwicklung seiner selbst, der Sorge um andere und der politischen Arbeit, und nennen das die "Vier-in-einem-Perspektive". Warum stehen Sie aktuellen Kampagnen für Arbeitszeitverkürzungen dennoch kritisch gegenüber?
Haug: Arbeitszeitverkürzungen allein, das reicht nicht: Man setzt sich für die Einführung von 35-Stunden-Wochen ein und somit für einen Vollzeit-Erwerbsarbeitsplatz und vergisst das wachsende Heer drumherum von Halbzeit, Teilzeit, Leiharbeit oder Prekariat. Im Prinzip bleibt aber alles beim Alten, weil das Thema Arbeitsteilung nicht aufgegriffen wird. Wir brauchen aber eine Arbeitsteilung, in der alle zusätzlich zur Erwerbsarbeit im häuslichen Bereich, im Freundes- und Liebesarbeitsbereich sowie an der Selbstentwicklung und im politischen Bereich arbeiten. Diese Bereiche neben der Lohnarbeit gibt es, und wir können es uns nicht leisten, sie nicht zu machen. Daher ist es nur vernünftig, die Lohnarbeit auf vier Stunden pro Tag zu verkürzen. Es ist auch ein einfaches Konzept und hört sich überhaupt nicht revolutionär an.
dieStandard.at: Es würde aber eine völlig andere Gesellschaftsordnung bedeuten. Wie soll das allein ökonomisch möglich sein?
Haug: Ich verstehe diesen Einwand nie so recht. Wenn auf einem bisherigen Acht-Stunden-Arbeitsplatz zwei Personen sitzen, die ein Einkommen haben sollen, von dem sie gut leben können, wie sollen sie dann plötzlich teurer sein, zumal Arbeitslose ja auch finanziert werden müssen? Außerdem könnten wir wirklich einmal anfangen, nach unten umzuverteilen. Das sehr aufklärerische Buch von Thomas Piketty hat ja gezeigt, dass das keine Erschütterung wäre. Die 1 Prozent, die das Weltvermögen besitzen, könnten zur Umverteilung herangezogen werden.
dieStandard.at: Es würde einen enormen Bewusstseinswandel voraussetzen. Wie soll der gelingen?
Haug: Es geht um die Frage der Veränderung der Lebensweise. Was soll die eigene Perspektive sein? Ich glaube nicht, dass es das größte Glück ist, einmal im Jahr zwei Wochen in einem Wellnesscenter zu sitzen, einmal die Woche shoppen zu gehen und zwischendurch mal die Wohnung völlig neu einzurichten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so glücklich ist. Und es ist doch eine wirklich wichtige Aufgabe zu diskutieren, was Glück ist – wie wollen wir in dieser Welt leben, und was ist ein gutes Leben?
dieStandard.at: Sie haben viel Erfahrung mit kontroversen feministischen Debatten und wurden häufig kritisiert, auf der Uni auch boykottiert. Wie schätzen Sie diese Reaktionen heute ein?
Haug: Ich vermute, dass solche Ausschlussverfahren im universitären Bereich auch den Nutzen hatten, dass die Anzahl der möglichen Stellen für manche erreichbarer wurde. Es ging also auch um Ressourcen. Es war auch die Zeit, als der Staat anfing, feministische Lehrstühle einzurichten. Ich war ja damals sehr hochnäsig und sagte mir, ich brauche keinen feministischen Lehrstuhl, ich mache ja Arbeitsforschung, bin Soziologin und Psychologin. Diese Lehrstühle sollen mal ruhig die nehmen, die nichts weiter als Feminismus gemacht haben. Als ich dann aber gar keinen Lehrstuhl bekam, wollte ich mich doch bewerben. Als einer für Feminismus und Sozialpsychologie ausgeschrieben wurde, nahm ich an, der wäre auf mich zugeschnitten – ich bin schließlich die einzige habilitierte Sozialpsychologin in der ganzen Republik. Mir wurde dann aber gesagt, ich komme nicht auf die Liste, weil ich die ganze Sektion dominieren würde, was sicher nicht ganz falsch war. Ich hatte ganz klare Vorstellungen, wie man Sozialisationsforschung macht, wie man lehrt.
Ich vertrat insgeheim sehr naiv einen meritokratischen Standpunkt – ich wusste ja, dass das keine meritokratische Leistungsgesellschaft ist, und wer die meisten Veröffentlichungen hat, genommen wird. Aber ich dachte, bei mir sei das anders. Ich war sträflich naiv. Aber ich konnte das alles ganz gut überleben, weil ich damals auch einen Ruf nach Toronto bekam.
dieStandard.at: Sie haben in Ihrem neuen Buch Texte publiziert, die schon 40 Jahre alt sind, und mit deren Inhalt Sie sich keineswegs mehr identifizieren können. Warum?
Haug: Ich wurde zu einer Konferenz eingeladen, und eine der Organisatorinnen fragte mich: "Wie kommt es, dass Sie in den 1970er-Jahren einen Aufsatz mit dem Titel 'Verteidigung der Frauenbewegung gegen den Feminismus' geschrieben haben, und kurze Zeit später setzen sie sich an die Spitze des Feminismus?" Das war sehr streng gesprochen, aber da wusste ich, ich muss das noch mal durcharbeiten. Erst dachte ich, der Text kann nicht so schlimm sein, aber dann war der jenseits dessen, was ich für möglich hielt, dass ich das jemals gesagt haben könnte – geschweige denn geschrieben und dann auch noch veröffentlichen habe.
dieStandard.at: Warum dann nochmals veröffentlichen?
Haug: Mir schien, dass meine Gegnerinnen etwa in der Arbeiterbewegung oder in linksgewerkschaftlich orientierten Gruppen ihre Einwände gegen mich aus meinem eigenen Beitrag hatten. Zu sehen, ich spreche eigentlich wie sie – das war ein Drama für mich. Ich habe sehr viel daraus gelernt, etwa dass ich als selbstverständlich angenommen habe, ich sei immer gleich gewesen. In der Darstellung der eigenen Person versucht man Widersprüche zuzudecken und sich als kohärent vorzuführen. Mir wurde klar, dass ich es lange nicht als notwendig empfunden habe, diese Widersprüche zu entdecken – obwohl ich genau das entlang des Konzepts der Erinnerungsarbeit gefordert habe. Man lernt so aber viel, weil man seinen eigenen Gegner in sich findet.
dieStandard.at: Kann diese Erinnerungsarbeit nicht von politischen Prozessen außerhalb ablenken, weil man zu sehr auf die persönliche Entwicklung fokussiert ist?
Haug: Manche missverstehen es als therapeutisches Instrument, das ist es aber nicht. Erinnerungsarbeit ist ein methodisches Analyseinstrument; Untersuchung der Weise, wie sich einzelne in die Gesellschaft eingebaut haben, welche Kompromisse sie dabei eingegangen sind oder wo sie eben gerade nicht politisch agiert haben, sondern personalisiert. Erst wenn man sieht, welche Wege man in der Vergangenheit gegangen ist, welche man ausgeschlagen hat, kann man sagen, welchen Weg man für die Zukunft gehen will. Es ist eine Übung in politischer Handlungsfähigkeit.
dieStandard.at: Sie haben mit anderen das Konzept der Erinnerungsarbeit entwickelt. Wie entstand die Idee?
Haug: Das Modell "Wir wissen, wo es langgeht, und zeigen es den anderen" ist individuell und kollektiv gescheitert. Wir haben damals in den späten 70er-Jahren in einer Frauengruppe gelernt und auch viel Leben miteinander verbracht. Wir wollten dann ein Buch über unser Lernen schreiben, nützlich für die Frauenbewegung. Als wir dann bei der Seite 80 sahen, dass noch immer keine Frauen in dem Buch vorkamen, sondern nur Männerhorden wie Jäger und Treiber, wussten wir, es würden die Frauen in der Bewegung nicht lesen und dass wir es anders machen müssen: Jede brachte ein oder zwei Seiten mit Erinnerungen daran mit, wie sie in unserer Gruppe gelernt hat. Erst war es ein Schock zu sehen, wie viel Ressentiment in diesen Geschichten lag, Neid, zu kurz gekommen sein, Eifersucht und so weiter. Kurz: Wir mussten lernen, dass wir alle unterschiedslos Kinder jener Verhältnisse waren wie auch die, die wir dachten, belehren zu können. So lernten wir: Wenn wir etwas über Frauenunterdrückung erarbeiten wollen und über das Verhältnis zum Lernen, dann können wir uns selbst als Material sehen und sind Subjekt und Objekt der Forschung in einem. (Beate Hausbichler, 3.7.2015)