
Es waren neue und verstörende Bilder von Körper, die die Menschen durch die Pandemie zu Gesicht bekamen. Der Umgang mit Verletzlichkeit hat sich dadurch aber kaum verändert, sagt Jule Govrin.
Wer besonders von Ausbeutung betroffen ist, das bestimmen noch immer zu einem Großteil Verfasstheit und Aussehen von Körpern. Daran hätten auch neue Erfahrungen während der Corona-Pandemie, wie etwa die Abhängigkeit voneinander, kaum etwas geändert, sagt die Philosophin Jule Govrin. Die Philosophin befasst sich in ihrem aktuellen Buch "Politische Körper" mit Verkörperung und Verwundbarkeit unter dem "pandemischen Körper".
STANDARD: Warum ist die Perspektive auf Körperlichkeit derzeit so interessant?
Govrin: Als die Pandemie aufkam, waren wir auf einer affektiven und ästhetischen Ebene mit völlig neuen Körperbildern konfrontiert: die Masken auf den Gesichtern, die Körper in Schutzkleidung, Körper, die auf Abstand gehen. Solidarität wurde unter neuen und anderen Vorzeichen gelebt, nicht durch Nähe, sondern durch körperliche Distanz. Doch trotz dieser neuen und auch verstörenden Körperbilder zirkulierten im Grunde die alten Körperordnungen, wie sie sich schon lange durch die Moderne ziehen. Das alles war für mich ein geeigneter Ansatzpunkt, um philosophisch und politisch nochmal anders über Körper und Verkörperung nachzudenken.
STANDARD: Zu diesen alten Körperordnungen: Warum funktionierten die Konstruktionen von Unter- und Überlegenheit entlang einer willkürlichen Interpretation von Körpern, z. B. einer rassistischen oder sexistischen, noch immer?
Govrin: In Körpern werden Differenzen eingeschrieben, rassifizierte Körper, feminisierte Körper, queere Körper, versehrte Körper, prekäre Körper, arme Körper – sie werden am meisten ausgebeutet. Das bezeichne ich als differenzielle Ausbeutung, denn diese verfährt auch derart, dass Menschen in unterschiedlichem Ausmaß prekarisiert werden, etwa in der Ausbeutung migrantischer Arbeit oder der unbezahlten Sorgearbeit, die meist Frauen stemmen. Um Ökonomie zu verstehen, müssen wir nicht bei abstrakten wirtschaftswissenschaftlichen Modellen, sondern schlichtweg bei den körperlichen Auswirkungen von Wirtschaftspolitiken ansetzen, beispielsweise durch Austeritätsmaßnahmen. Von da aus können wir zu einer Ökonomiekritik von unten kommen.
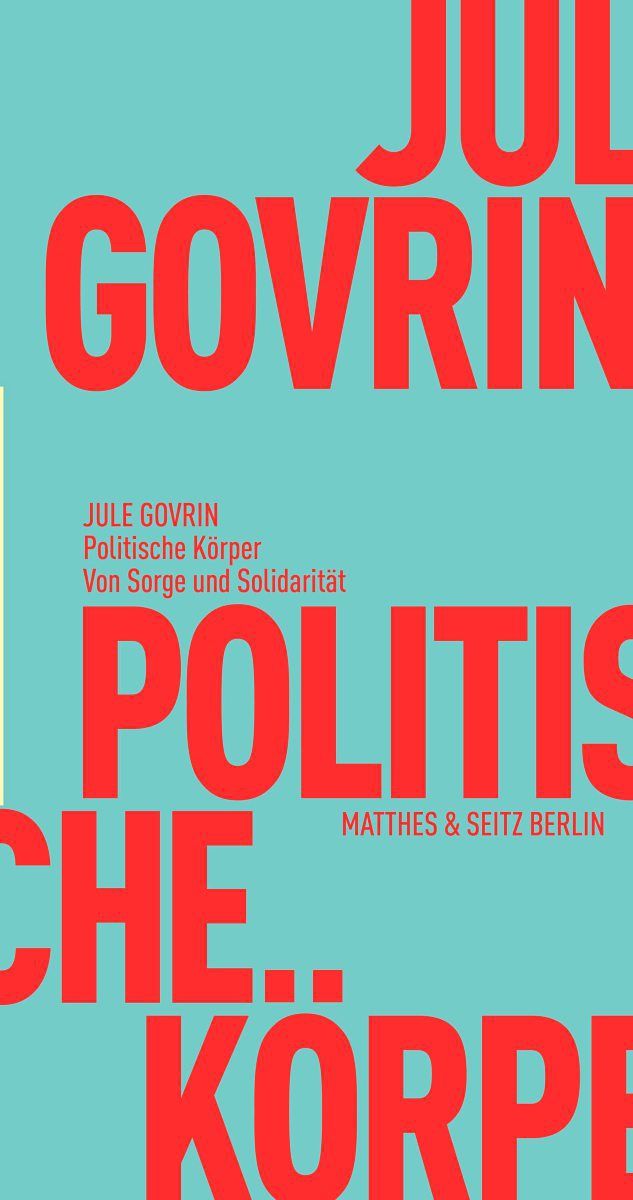
Es gibt zwei zentrale Stränge, kapitalistische Körperordnungen kritisch zu betrachten: zunächst die materialistische marxistische Lesart, die die materielle Ungleichheit von Körpern anschaut, also wie Körper durch die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft ungleich gemacht werden. Hinzu kommt der poststrukturalistisch geprägte Theoriestrang, der die symbolischen Einschreibungen von Differenzen der Körper in den Blick nimmt, zum Beispiel, wie Körper im Neoliberalismus zu einem Ideal der Leistungsgesellschaft und Durchsetzungskraft gemacht werden. Dieser Strang ist eng mit feministischer und postkolonialer Kritik verbunden und folglich mit der Frage, wie Körper durch Differenzeinschreibungen abgewertet und ungleich gemacht werden. Doch um Ungleichheit ausgehend vom Körper zu verstehen, müssen wir die materielle und die symbolische Ungleichmachung zusammendenken und uns ansehen, wie materielle Bedingungen und symbolische Einschreibungen einander verstärken.
STANDARD: Sie haben die neuen Bilder von Solidarität in den ersten Monaten der Covid-Krise angesprochen. Wären diese nicht eine Chance für einen fest in der Gesellschaft verankerten Solidaritätsbegriff gewesen?
Govrin: Ich würde zwischen politischen Reden über Solidarität und einer sozialen Sehnsucht nach Solidarität unterscheiden. Der Begriff der Solidarität war ähnlich wie der Begriff der Vulnerabilität ein Schlagwort im pandemiepolitischen Vokabular. Doch wenn wir daran denken, welche Körper geschützt wurden und welche nicht, zeigte sich, dass diese Appelle an solidarischen Zusammenhalt von einem sehr begrenzten "wir" ausgehen. Pflegekräfte haben zwar symbolische Anerkennung bekommen, aber vonseiten der Regierungen wurde weiterhin mit der maximalen Auslastung und Erschöpfung von Pflegekräften kalkuliert. Dennoch wurde in der Pandemie eine soziale Sehnsucht nach Solidarität sichtbar – auch ganz praktisch. Es gab viele Ausdrücke spontaner Solidarität, zum Beispiel durch Nachbarschaftshilfe. Auf dieser Ebene, im Sozialen und Gemeinschaftlichen, hat sich was verändert. Gerade weil sie auf einmal isoliert waren, sind Menschen in anderer Form in Kontakt gegangen.
STANDARD: Sie verwenden in Ihrem Buch den Begriff Nekropolitik. Was bedeutet das?
Govrin: Diesen Begriff entwirft Achille Mbembe aufbauend auf den Begriff der Biopolitik von Michel Foucault. Das Konzept der Nekropolitik ist in Bezug auf die internationale Arbeitsteilung und die Tatsache, dass der Wohlstand des Westens immer noch auf der Ausbeutung des globalen Südens und der dortigen Arbeit beruht, wegweisend. Manche Menschen werden dazu angerufen, ihr Leben biopolitisch zu pflegen und zu kuratieren, um leistungsfähig zu sein. Andere hingegen werden allein als Körpermasse von Arbeitskräften angesehen, als Reservearmee von billigen und verwertbaren Arbeitskräften, nützlich und verfügbar – sind sie das nicht, werden sie dem Sterben überlassen. Wie etwa bei der nekropolitischen Grenzpolitik der EU.
STANDARD: Sie schreiben, dass trotz des Gleichheitsanspruchs, der mit der Aufklärung aufkam, weiter stark unterschieden wurde, wer mehr und wer weniger wert ist – bis heute. Mit welchen Argumenten wird das heute gemacht?
Govrin: Es wird eher selten offen argumentiert, manche Körper seien weniger wert als andere – so offen vertreten diese Position nur rechte Stimmen. Dennoch werden in der Praxis kapitalistischen Wirtschaftens Körper strukturell ungleich gemacht. Und diese Ungleichmachung wird beharrlich ausgeblendet, zumindest von denen, die sich in geschützter Position befinden. Doch je bedrohlicher die Krisenlage der Welt, desto weniger lässt sich dies verschleiern. Das hat die Corona-Krise deutlich gemacht: Zum einen hat uns die Pandemie bewusst gemacht, dass wir eine allgemeine Verwundbarkeit teilen. Zum anderen wurde sichtbar, wie bestimmte Körper stärker prekarisiert werden, ich spreche hier von struktureller Verwundbarmachung.

Es gab stille Triagen –in Schweden, aber auch in Österreich oder Deutschland,–, manchen älteren Menschen wurden keine lebenserhaltenden Maßnahmen gewährt. Das wurde wenig thematisiert. Zwar gab es einige grelle Stimmen, etwa jene des früheren Vizegouverneurs von Texas, Dan Patrick, aber auch von Politiker wie Wolfgang Schäuble oder Boris Palmer, die suggerierten, man solle das Leben älterer Menschen opfern – für das Überleben des Marktes. Aber Aussagen wie diese sind die Ausnahmen. In der Politik würde sich kaum jemand hinstellen und fordern, dass wir zum Beispiel Menschen mit Behinderungen in Notlagen wie der Pandemie opfern sollten. Dennoch gibt es diese eugenischen Tendenzen, zum Beispiel bei den Diskussionen um die Ex-Post-Triage, also den rückwirkenden Entzug lebensherhaltender Maßnahmen, die sich in Gesetzesvorlagen übersetzen. Noch subtiler war die wohlklingenden Reden über den Schutz der sogenannten Vulnerablen, die umso lauter wurden, je mehr man basale solidarische Schutzmaßnahmen wie Maskentragen im Supermarkt aufkündigte.
STANDARD: Bei Protestbewegungen ist der Körper zentral, allein durch seine Präsenz in großen Mengen auf der Straße. Welche Protestbewegungen finden Sie besonders interessant?
Govrin: Wegweisend sind für mich sind jene Proteste und Bewegungen, die sich gegen Formen der strukturellen Verwundbarkeit und der differenziellen Ausbeutung wenden und dabei von einer geteilten Verwundbarkeit ausgehen, die eine kollektive Handlungsmacht ermöglicht. Also Bewegungen, die nicht Idealen von individueller Stärke und Resilienz nachhängen, sondern nach neuen kollektiven Formen des Miteinander suchen. Beispielsweise die feministische Streikbewegung, die sich gegen Femizide wendet und zugleich alternative Sorgeökonomien hervorbringt. Es geht eben nicht allein darum, auf der Straße zu protestieren, sondern sich kommunal anders zu organisieren – mit kommunalen Küchen oder kommunalen Kitas. Sie stellen das Gemeinwohl in den Vordergrund und üben andere Formen des Wirtschaftens ein. Dies bedeutet auch ein bewusstes Verlernen der neoliberalen Wettstreitlogik – und dadurch entstehen egalitäre Körperpolitiken.
STANDARD: Ist es das, was Sie unter Universalismus von unten verstehen?
Govrin: Ja genau, in all diesen solidarischen Praktiken, in denen Menschen einander Schutz und Sorge spenden, in denen sie sich jenseits vom privaten, unternehmerischen Profitinteressen organisieren, zeigen sich Anzeichen einer Gleichheit von unten, einer Gleichheit als prekäre Praxis. Diese egalitären Körperpolitiken begreife ich als Spuren eines Universalismus von unten. Ein Universalismus, der nicht von Regierungen gewährt wird, sondern in den solidarischen Gefügen entsteht, der nicht auf Homogenität, sondern auf Heterogenität beruht. Ein Universalismus von unten, der die bestehenden universalistischen Normen in ihren Ausschlüssen anfechtet und sie durch diese Kritik erweitert. Der linke Identitätspolitiken wie die feministische Streikbewegung oder Black Lives Matter in ihrem geteilten Anliegen, dass alle Menschen gleicherma0en Schutz erfahren sollten, verbindet. (Beate Hausbichler, 11.12.2022)